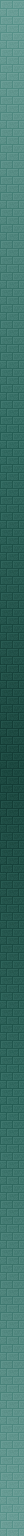
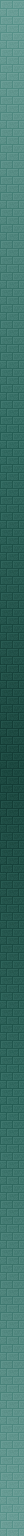
 Liebe Kleingartenfamilie!
Liebe Kleingartenfamilie!
Während ich diese Zeilen schreibe, erfüllt mich ein Gefühl der Dankbarkeit und des Stolzes – Dankbarkeit für das, was wir gemeinsam als internationale Kleingartenfamilie im vergangenen Jahr erreicht haben, und Stolz auf die Kraft, die in unserer Gemeinschaft steckt.
Das Jahr 2025 war geprägt von Herausforderungen, aber auch von schönen Momenten, die gezeigt haben, wie wertvoll unser Engagement für die Kleingartenbewegung ist.
Wenn ich auf die vergangenen Monate zurückblicke, sehe ich vor allem eines: Die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Gärten spiegeln sich in der Vielfalt und Lebendigkeit unserer Gemeinschaft wider. Wir haben Jubiläen gefeiert, neue Projekte angestoßen und bestehende Freundschaften vertieft. Besonders die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Schweizer Familiengärtner-Verbandes haben eindrucksvoll gezeigt, wie tief verwurzelt die Kleingartenbewegung in unseren Städten und Herzen ist. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir dieses Fest gemeinsam begehen konnten und dabei erleben durften, wie sehr uns das gemeinsame Ziel verbindet: Die Bewahrung und Weiterentwicklung unserer grünen Oasen inmitten einer sich stetig wandelnden Welt.
Denn unsere Kleingärten sind weit mehr als nur Orte des Anbaus von Obst und Gemüse. Sie sind Refugien für Tiere und Pflanzen, grüne Lungen der Städte, Orte der Erholung und Begegnung. In einer Zeit, in der Klimawandel, Urbanisierung und gesellschaftliche Veränderungen uns vor neue Aufgaben stellen, leisten unsere Gärten einen unschätzbaren Beitrag für Umwelt, Klima und Lebensqualität.
Was unsere Bewegung so besonders macht, ist das gelebte Miteinander. In unseren Vereinen begegnen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen und Lebensgeschichten. Am Gartenzaun werden Erfahrungen ausgetauscht, Tipps weitergegeben, Ernte geteilt und gemeinsam gefeiert. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen sich nach Zugehörigkeit und echter Nachbarschaft sehnen, bieten unsere Kleingärten einen Ort, an dem Gemeinschaft nicht nur ein Wort, sondern gelebte Realität ist. Die Solidarität, die in unseren Anlagen spürbar ist, gibt Kraft und Zuversicht – und sie ist ein Vorbild für das gesellschaftliche Zusammenleben weit über die Gartenpforte hinaus.
Unsere Kleingärten sind Orte, an denen Nachhaltigkeit tagtäglich praktiziert wird. Wir achten auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen, fördern die Artenvielfalt durch naturnahe Bepflanzung und verzichten auf Pestizide. Viele von uns legen Komposthaufen an, sammeln Regenwasser, pflegen alte Obstsorten und schaffen Lebensräume für Insekten und Vögel. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kleingärten Hotspots der Biodiversität sind. Jeder Blühstreifen, jede Obstwiese, jedes Kräuterbeet in unseren Gärten ist ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. In vielen Städten sind Kleingärten oft die letzten Rückzugsorte für bedrohte Arten. Sie sind lebendige Beispiele dafür, wie nachhaltige Bewirtschaftung und Liebe zur Natur Hand in Hand gehen können.
Auch der gesundheitliche Wert unserer Gärten darf nicht unterschätzt werden. Die Bewegung an der frischen Luft, das Erleben der Natur und das gemeinsame Tun fördern nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit. Studien belegen, dass regelmäßige Gartenarbeit Stress reduziert, das Wohlbefinden steigert und sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Besonders in unserer schnelllebigen Zeit bieten unsere Gärten einen Ausgleich, der Körper und Seele guttut. Wir wissen, wie wohltuend es ist, nach einem arbeitsreichen Tag, im Grünen zur Ruhe zu kommen.
Ein weiteres zentrales Thema dieses Jahres war die Weitergabe von Wissen und Traditionen. Seit über 100 Jahren kultivieren wir unsere Gärten und haben dabei einen reichen Schatz an Erfahrungen gesammelt. Dieses Wissen um Anbau, Ernte und Konservierung von Lebensmitteln geben wir an unsere Kinder und Enkel weiter – ein Wert, der gerade in Krisenzeiten von unschätzbarer Bedeutung ist. Die diesjährige Studientagung in Tulln hat sich intensiv mit dem Thema „Vorbereitet sein auf Krisen“ beschäftigt und gezeigt, wie wichtig unsere Gärten für die Versorgungssicherheit und die Resilienz unserer Gesellschaft sind.
Auch 2025 konnten wir im Rahmen zweier Treffen unsere gemeinsame Arbeit intensivieren. Bei der Generalversammlung in Luxemburg und der Studientagung in Tulln wurde einmal mehr der Enthusiasmus spürbar, mit dem alle an der Weiterentwicklung unserer Ideen und Ziele arbeiten. Mit einer Stimme, die über zwei Millionen Kleingartenfamilien vertritt, haben wir die Möglichkeit, uns auf nationaler und europäischer Ebene bei politischen Entscheidungsträgern Gehör zu verschaffen – eine Chance, die wir zukünftig noch stärker nutzen müssen.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die sich mit Herzblut und Engagement für unsere Bewegung einsetzen – sei es im eigenen Garten, im Verein, auf nationaler oder internationaler Ebene. Ihr seid es, die unsere Gemeinschaft lebendig halten, die neue Ideen einbringen und Traditionen bewahren. Ohne euren Einsatz, eure Kreativität und eure Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wäre all das nicht möglich. Ihr seid das Herz unserer Bewegung.
Zum Abschluss dieses Jahres möchte ich Sie alle ermutigen, weiterhin mit Zuversicht, Tatkraft und Freude an der Entwicklung unserer Kleingärten zu arbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Gärten auch in Zukunft Orte der Vielfalt, der Nachhaltigkeit und des Miteinanders bleiben. Lassen Sie uns stolz sein auf das, was wir erreicht haben, und mutig die Herausforderungen annehmen, die vor uns liegen. Gemeinsam können wir viel bewegen – für unsere Städte, unsere Umwelt und unsere Gesellschaft.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben erholsame Feiertage und alles Liebe sowie Gesundheit für das neue Jahr 2026. Möge es ein Jahr voller Freude, Gemeinschaft und gemeinsamer Erfolge werden!
Mit herzlichen Grüßen
Sylvia Wohatschek
Generalsekretärin
Fédération Internationale des Jardins Familiaux
 Der Schatz unter unseren Füßen
Der Schatz unter unseren Füßen
Am 5. Dezember wird weltweit der Weltbodentag begangen. Dieser Tag erinnert uns daran, wie unverzichtbar gesunde Böden für unser Leben sind. Böden sind mehr als nur „Erde“ – sie sind die Grundlage für unsere Ernährung, sie speichern Wasser, binden Kohlenstoff und sind Lebensraum für Milliarden von Mikroorganismen, Insekten und Pflanzen. Ohne fruchtbare Böden gibt es keine Artenvielfalt, keine Landwirtschaft und keinen wirksamen Klimaschutz.
Warum ist das wichtig?
• Böden sind Klimaschützer: Sie speichern große Mengen an CO₂ und helfen so, den Klimawandel zu bremsen.
• Böden sind Wasserspeicher: Gesunde Böden nehmen Regen auf und verhindern Überschwemmungen.
• Böden sind Lebensräume: Ein Teelöffel Erde enthält mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde!
Kleingärten als Hüter des Bodens
Kleingärten sind wahre Schutzräume für unsere Böden. Während in Städten immer mehr Flächen versiegelt werden, bleiben Kleingärten grüne Inseln, die den Boden bewahren und pflegen. Sie sind Orte, an denen nachhaltige Bodennutzung praktisch gelebt wird:
• Natürliche Kreisläufe statt Abfall: Kleingärtnerinnen und Kleingärtner kompostieren organische Abfälle und führen Nährstoffe zurück in den Boden. So entsteht Humus, der die Bodenstruktur verbessert und die Fruchtbarkeit erhält.
• Vielfalt statt Monokultur: Kleingärten sind bunt – Gemüsebeete, Obstbäume, Blumen und Sträucher wechseln sich ab. Diese Vielfalt fördert ein aktives Bodenleben und schützt vor Bodenerosion.
• Verzicht auf Chemie: Viele Kleingärtner setzen auf biologische Methoden und verzichten auf Pestizide und Kunstdünger. Das schützt nicht nur den Boden, sondern auch das Grundwasser und die Artenvielfalt.
• Lebensraum für Bodenorganismen: Regenwürmer, Mikroorganismen und Pilze finden in naturnah bewirtschafteten Gärten ideale Bedingungen. Sie lockern den Boden, verbessern die Wasseraufnahme und sorgen für ein stabiles Ökosystem.
• Klimaschutz im Kleinen: Gesunde Böden in Kleingärten speichern Kohlenstoff und tragen so zur Reduzierung von Treibhausgasen bei. Jeder Quadratmeter zählt!
Kleingärten sind damit nicht nur Orte der Erholung, sondern auch wichtige Partner im Kampf gegen Klimawandel und Artenverlust. Sie zeigen, wie Bodenschutz im Alltag funktioniert – direkt vor unserer Haustür.
Was können wir tun?
• Kompost anlegen und richtig pflegen
• Boden nicht unnötig umgraben, um das Bodenleben zu erhalten
• Mulchen, um Feuchtigkeit zu bewahren und Erosion zu verhindern
• Auf chemische Dünger und Pestizide verzichten
Der Weltbodentag ist eine Einladung, den Boden wertzuschätzen – denn er ist die Grundlage für alles Leben. Jeder Kleingarten ist ein Stück Zukunft: für uns, für die Natur und für das Klima.
https://www.fao.org/world-soil-day/
 Kleingärten als Vorreiter für Nachhaltigkeit
Kleingärten als Vorreiter für Nachhaltigkeit
Die Europäische Woche der Abfallvermeidung ist eine Initiative, die jedes Jahr im November stattfindet und das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen stärkt. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden, bevor sie entstehen – durch kluge Entscheidungen im Alltag, nachhaltige Konsumgewohnheiten und kreative Lösungen.
Kleingärten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind nicht nur Orte der Erholung, sondern auch Zentren für umweltbewusstes Handeln. Hier wird Kreislaufwirtschaft praktisch gelebt:
• Kompostierung statt Müll – Gartenabfälle werden zu wertvollem Humus, der den Boden nährt und chemische Dünger ersetzt.
• Eigenanbau statt Verpackungsmüll – Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten reduziert Plastikverpackungen und Transportwege.
• Upcycling und Wiederverwendung – Aus alten Materialien entstehen neue Beete, Rankhilfen oder dekorative Elemente.
Darüber hinaus fördern Kleingärten die Artenvielfalt und tragen zum Klimaschutz bei: Jeder Quadratmeter Grünfläche bindet CO₂, bietet Lebensraum für Insekten und unterstützt die lokale Biodiversität.
Die Europäische Woche der Abfallvermeidung lädt alle Kleingärtnerinnen und Kleingärtner ein, ihre Ideen sichtbar zu machen:
• Kompost-Workshops
• Tauschbörsen für Pflanzen und Saatgut
• Aktionen zur Reduzierung von Plastik im Garten
So wird aus einem kleinen Garten ein großer Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.
 Als Anlage finden Sie die Resolution, die von den, im Ausschuss für Umwelt- und Gesundheitskrisen der Konferenz der INGOs des Europarates, beteiligten NROs als Beitrag zum derzeit in Belém (Brasilien) stattfindenden Gipfel verabschiedet wurde.
Als Anlage finden Sie die Resolution, die von den, im Ausschuss für Umwelt- und Gesundheitskrisen der Konferenz der INGOs des Europarates, beteiligten NROs als Beitrag zum derzeit in Belém (Brasilien) stattfindenden Gipfel verabschiedet wurde.
Der Gipfel befasst sich mit Herausforderungen, die ohne gemeinsames Engagement nur schwer zu lösen sind.

Vom 21. bis 24. August 2025 fand die Studientagung der Fédération Internationale des Jardins Familiaux in Tulln an der Donau statt. Die Vertreter und Vertreterinnen von zehn europäischen Nationen trafen sich zu einem Austausch im Seminarzentrum der Landesgartenschau „Die Garten Tulln“.
Das Thema der diesjährigen, durch den österreichischen Verband ausgerichteten, Studientagung war: „Wir sind vorbereitet – Welche Antworten wir Kleingärtner auf heutige Krisen haben.“
Kleingärtner und Kleingärtnerinnen sind ein wichtiger Baustein, wenn es um den Klimaschutz geht (Artenvielfalt, Abkühlung der Städte, etc.). Sie verfügen über ein breites Wissen, wie sie durch Nachhaltigkeit nicht nur die Umwelt und Ressourcen schonen, sondern auch, wiesie sich selbst versorgen können. All diese Kompetenzen sind wertvoll, wenn es darum geht, auf heutige Krisen zu reagieren.
Das Ziel der Studientagung war der Erfahrungsaustausch mit den internationalen Organisationen, um aus den Erkentnissen zu lernen und nachahmenswerte Projekte in den eigenen Nationen umzusetzen.
Neben dem intensiven Austausch der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden auch Vorträge von Spezialisten aus diversen Organisationen in deutscher und englischer Sprache angeboten.
Natürlich bot sich als Rahmenprogramm eine spezielle Führung durch „Die Garten Tulln“ mit ihren 70 Mustergärten an, um nicht nur theoretische sondern auch praktische Erfahrungen zu sammeln.
Auch eine Einladung im Kleingartenverein Krems an der Donau stand auf dem Programm. Im Zuge dieses Besuches - bei dem die internationale Kleingartenfamilie außerordentlich herzlich empfangen wurde – durften sich einige österreichische Vereine über die Verleihung der internationalen Ehrenurkunden freuen.
Donnerstag 21. August - Anreisetag
Die Gäste waren in einem 15 Gehminuten vom Veranstaltungsort gelegenem Hotel untergebracht. Zuerst hielt die Fédération Internationale eine Verwaltungsratssitzung und Generalversammlung im Konferenzraum des Hotels ab. Anschließend führte ein gemütlicher Spaziergang durch die malerische Au zum Grillabend in das Restaurant Gaumenweide der „Garten Tulln“.
Freitag 22. August - Studientagung Tag 1
 Am Freitag fanden um 9.00 Uhr die Eröffnung der Studientagung statt. Die Teilnehmer wurden vom Hausherren von „Die Garten Tulln“, Geschäftsführer Franz Gruber, MSc, herzlich willkommen geheißen. (www.diegartentulln.at)
Am Freitag fanden um 9.00 Uhr die Eröffnung der Studientagung statt. Die Teilnehmer wurden vom Hausherren von „Die Garten Tulln“, Geschäftsführer Franz Gruber, MSc, herzlich willkommen geheißen. (www.diegartentulln.at)
Direkt im Anschluss starteten die ersten Programmpunkte. Beim „Speed Date“ fand ein Austausch der Nationen über die Herausforderungen und Maßnahmen in den Verbänden statt.
Des weiteren präsentierte die Leiterin des Samenarchives der „Arche Noah“, Mag.a Michaela Arndorfer, ihren Vortrag „Pflanzenreich auf kleiner Fläche“. (www.arche-noah.at)
Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen ging es mit der Vortragsreihe, die jeweils in deutsch und englisch abgehalten wurden, weiter.
Der Leiter der CITY FARM Wien, Dipl. Ing. Wolfgang Palme, beeindruckte mit seinem Vortrag „4-Jahreszeiten-Gärtnern“ über die Möglichkeiten der ganzjährigen Gartennutzung. (www.cityfarm.wien)
 Florian Binder, Biodiversitätsbeauftragter des Zentralverbandes Österreich brachte den Zuhörern den „klimafitten-Garten“ durch Umsetzungsideen näher.
Florian Binder, Biodiversitätsbeauftragter des Zentralverbandes Österreich brachte den Zuhörern den „klimafitten-Garten“ durch Umsetzungsideen näher.
Als letzter Programmpunkt fand eine Führung durch „Die Garten Tulln“ statt. In Europas erste ausschließlich ökologisch gepflegter und gestalteter Gartenschau, erhalten Interessierte anhand der 70 Mustergärten praktische Anregungen, Ideen und Inspirationen, wie sie ihren eigenen Garten gestalten können.
Mit dem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Gaumenweide“ endete ein erfolgreicher erster Tag der Studientagung. (www.gaumenweide.at)
Samstag 23. August - Studientagung Tag 2
Der zweite Tag begann um 9.00 Uhr mit weiteren Vorträgen und anschließenden Diskussionen der internationalen Gäste.
Von der Bewegung des Bundeslandes Niederösterreich „Natur im Garten“ hielt Frau Margit Benes-Oeller einen sehr informativen Vortrag über „Wassermanagement“ im Garten. (www.naturimgarten.at)
Guido Beneke, Geschäftsführung bei Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e. V., stellte die Kleingärten als Begegnungsort der Generationen, sowie die daraus resultierenden Herausforderungen und Lösungen, in den Fokus seines Vortrags. (www.deutsche-schreberjugend.de)
Nach dem gemeinsamen Mittagessen setzte Marius Monen von der Avans University of Applied Sciences, mit seiner Analyse „Wie Kleingärtner zu innovativen Lösungen für widerstandsfähige städtische Grünflächen beitragen können.“, den Schlusspunkt der Vortragsreihe.
 Als nächster stand ein Besuch der Kleingartenanlage „Krems an der Donau“ (www.kgv-krems.at) auf dem Programm. Die internationalen Gäste wurden herzlich begrüßt und zu einem Rundgang durch die Anlage eingeladen. In zwei Gruppen konnten sie einen Streifzüge durch die Gärten unternehmen. So ergaben sich zahlreiche persönliche Gespräche und Einblicke in die liebevoll gestalteten Parzellen.
Als nächster stand ein Besuch der Kleingartenanlage „Krems an der Donau“ (www.kgv-krems.at) auf dem Programm. Die internationalen Gäste wurden herzlich begrüßt und zu einem Rundgang durch die Anlage eingeladen. In zwei Gruppen konnten sie einen Streifzüge durch die Gärten unternehmen. So ergaben sich zahlreiche persönliche Gespräche und Einblicke in die liebevoll gestalteten Parzellen.
Der gesellige Rahmen beim Vereinshaus wurde auch dazu genutzt, die Ehrenurkunden der Fédération Internationale des Jardins Familiaux an verdienstvolle Vereine zu überreichen.
Aus Linz erhielt der Verein „Eisenbahner Kleingartenverein“ die Ehrenurkunde für naturgerechtes Gärtnern und der Verein „Auwiesen I“ für soziale Tätigkeiten. Beide Ehrungen wurden durch den Präsidenten des Landesverbandes der Kleingärtner Oberösterreich, Josef Reisinger entgegengenommen.
Über die internationale Ehrung für innovative Projekte durfte sich der Verein „Groß Jedlersdorf“ freuen. Die Auszeichnung konnte direkt an Ernest Kern, Obmann des Vereines aus Wien Floridsdorf, übergeben werden.
Zu guter Letzt wurden auch die Damen der „Frauenfachgruppe Floridsdorf“ mit einer Ehrenurkunde für soziale Tätigkeiten bedacht. Seit vielen Jahren sind sie mit ihrem Einsatz für den guten Zweck ein wichtiger Bestandteil der Kleingartenfamilie. Die Ehrung wurde von der sichtlich gerührten neuen Vorsitzenden der Frauenfachgruppe Gerda Grach entgegengenommen.
Auf dem Rückweg von Krems nach Tulln kehrten die Tagungsgäste bei einer typischen Weinschenke ein und konnten den letzten Abend gemütlich ausklingen lassen. (www.weinschenke-korntheuer.at)
Sonntag 24. August - Abreisetag
Nach dem Frühstück und einer anschließenden Generalversammlung im Hotel war es Zeit abschied von Tulln zu nehmen. Die sichtlich zufriedenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten viele Eindrücke und Erfahrungen in ihre nationalen Verbände mitnehmen, um die internationale Kleingartenfamilie zu stärken.